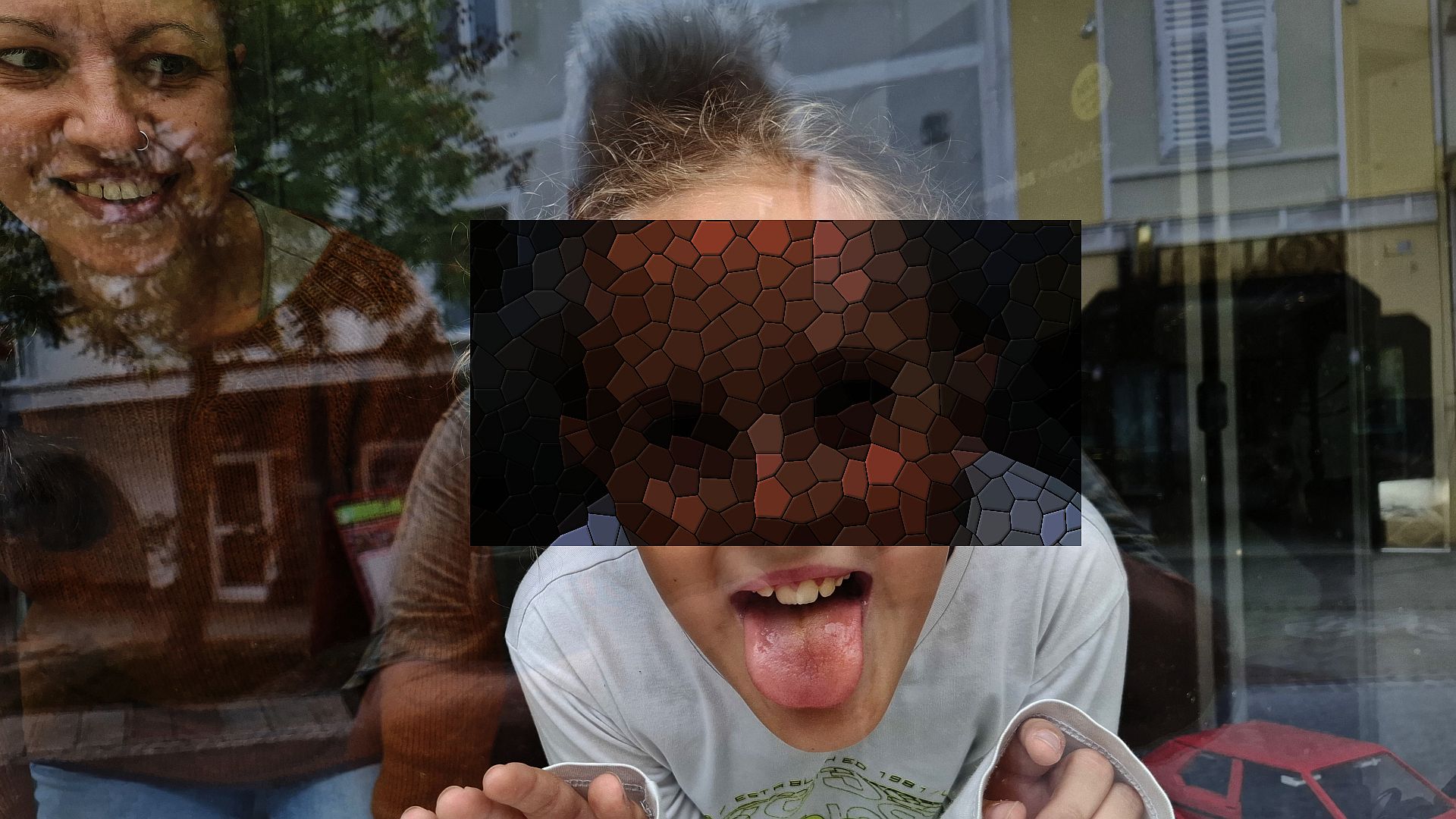Wir mußten es nicht erst debattieren, es war eine Übereinkunft, die sich fast von selbst ergab. Der Archipel ist keine Plattform für politischen Aktivismus. Das entstand allein schon aus der Tatsache, daß in jenem engeren Kreis, welcher den Archipel am Laufen hält, unterschiedliche Varianten der Weltanschauungen und der politischen Prioritäten gegeben sind.
Ist der Archipel deshalb „apolitisch“? Keineswegs! Aber Sie merken schon, das ist unter anderem eine semantische Frage. Was wird mit dem Begriff „politisch“ bezeichnet? In unserer europäischen Ideengeschichte steht das Wort für zweierlei. Erstens für die „Staatskunst“, also für das, was unser politisches Personal im Amt tut.
Zweitens ist das Politischen, was die Zivilgesellschaft tut, um ihr(e) Gemeinwesen zu gestalten. Aus dem vorigen Jahrhundert stammt ferner in Anerkennung der sozialen Brisanz aller Handlungen der Slogan „Das Private ist politisch“. Dieser Satz kommt aus den Frauenbewegungen der 1970er Jahre.
Ich erinnere mich genau, wie gerne mein Vater betonte, was „in den eigenen vier Wänden“ geschehe, gehe „die Leute draußen“ nichts an. Und das war oft genug nichts Gutes. Privatleben, öffentliches Leben, politische Funktionen und Amtsgeschäfte, ich muß Ihnen ja nicht erst erklären, wie sehr das alles in Wechselwirkung kommen kann.
Nun aber der Archipel?
Der beruht im Kern auf einem Grundkonsens, welcher auf jeden Fall von Kriterien zur Achtung der Menschenwürde handelt. Jenseits davon ist Dissens manchmal unvermeidlich. Das verträgt sich ausgezeichnet mit der Forderung nach Antwortvielfalt in einer pluralistischen Gesellschaft. Deshalb wäre es aber töricht, im Verein Kollisionen zu riskieren.
Wo es unvereinbare Positionen geben mag, gilt ein soziokulturelles Ideal: Zu schauen, was wir teilen, was wir gemeinsam haben, wo wir meist viel schneller geklärt haben, was die trennenden Ansichten sind. Es ist naheliegend, solche Belange mit künstlerischen Mitteln zu bearbeiten. Es wäre dumm, allfällige Differenzen so in den Mittelpunkt zu holen, daß sie die Fundamente des Archipels beschädigen.
Vielleicht ist es mit dem Bild sich berührender, auch überlappender Kreise ganz gut darstellbar. Der Vorstand ist gewissermaßen das „Regierungsviertel“ des Archipels, hat Pflichten und Befugnisse, um das ganze Gefüge stabil zu halten. Rund um dieses „Regierungsviertel“ bilden sich autonome Teilprojekte; metaphorisch betrachtet: „Teilrepubliken“, in die der Vorstand nicht hineinregiert.
Da sorgt bloß jeweils eine verantwortliche Schlüsselperson für die gedeihliche Verbindung zwischen den einzelnen Instanzen. Hier eine aktuelle Übersicht des archipelischen Netzwerkes eigenständiger Teilprojekte: [Link]
Es gibt auch Themenfelder, auf die sich Kulturschaffende vielleicht nicht ohne weiters einlassen möchten oder von denen sie sich derzeit überfordert fühlen könnten. Dabei kommt eine Frage der Sensibilität ins Spiel. Als ein konkretes Beispiel. Ich befasse mich gerade eingehender mit der Geschichte von Gewalttätigkeit und Krieg in meiner Kolumne: „Mars“.
Das hat in dieser Dichte derzeit kein breiteres Interesse innerhalb der Archipel-Community. Deshalb behandle ich es innerhalb meiner eigenen Domäne, also außerhalb des Archipels. Das heißt aber nicht, die Thematik wäre im Archipelischen fremd. Ich arbeite gemeinsam mit Regisseur Fritz Aigner am Archipel-Projekt „Gedenken: Was zu tun!“
Wir suchen eben immer in Abstimmung mit der „inneren Gemeinschaft“ des Archipels die passenden Themenschwerpunkte und Modi. Anders hätte eine autonome Kulturformation wie unsere keinen Bestand. Es geht nur mit einem stets neuen Kosnens.